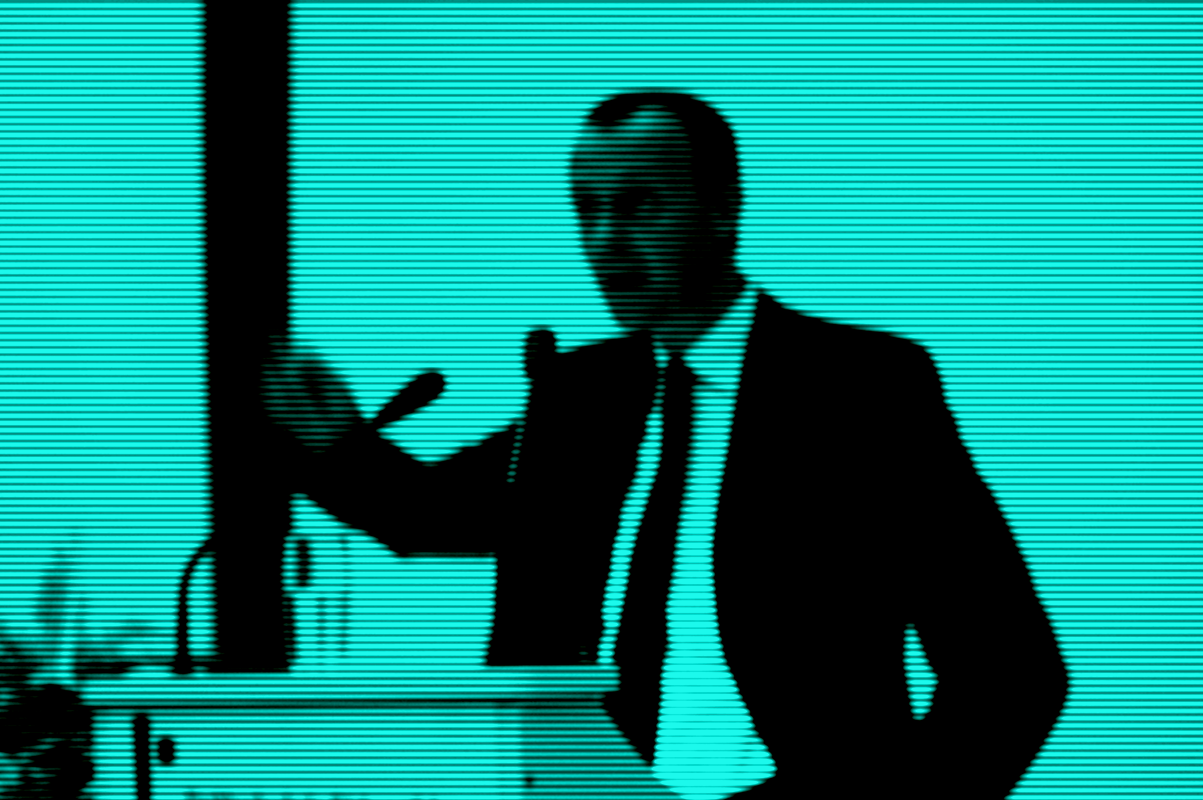Interview mit Dr. Gregor Gysi (Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion DIE LINKE)
Viele Menschen stimmen grundsätzlich den Forderungen progressiver Parteien zu. Warum spiegelt sich das nicht in Wahlergebnissen wider?
Am meisten wohl deshalb, weil viele Menschen diesen Parteien nicht zutrauen, ihre progressiven Forderungen gegen die Widerstände von starken Lobbygruppen in politische Veränderungen umzusetzen. Das wird noch durch die Erfahrung verstärkt, dass auch progressive Parteien, wenn sie Teil einer Regierungskoalition sind, nicht selten das Gegenteil von dem tun, was sie im Wahlkampf zuvor forderten. Wenn man sich Wahlplakate der Grünen zum Thema Waffenlieferungen anschaut und jetzt sieht, wer unablässig immer mehr nach der Lieferung schwererer Waffen an die Ukraine ruft, weiß man, was ich meine. Aber auch Die Linke ist davon nicht frei.
Du giltst als begnadeter Rhetoriker. Es ist wichtig, politische Inhalte zu kommunizieren. Müssen Progressive ihre Sprache verändern, damit die Botschaften auch hängenbleiben?
Wir dürfen nie vergessen, dass die meisten Menschen pro Tag vielleicht eine Viertelstunde Zeit haben, sich mit Politik zu beschäftigen und schon deshalb weder alle Begrifflichkeiten noch argumentativen Verästelungen nachvollziehen können, die die Politik prägen. Das heißt, wir müssen übersetzen, das Komplizierte verständlich machen.
Was ist in der politischen Kommunikation effektiver – Emotion oder Vernunft?
Am wichtigsten ist die Glaubwürdigkeit. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass die Gründe für bestimmte Entscheidungen, die öffentlich genannt werden, höchstens die halbe Wahrheit sind, wenden sie sich irgendwann von der Politik ab. 38,5 Prozent der Wahlberechtigten haben bei der letzten Bundestagswahl keine der etablierten demokratischen Parteien gewählt. Das muss allen Sorgen bereiten, denen die Demokratie am Herzen liegt.
In den letzten Jahrzehnten hat sich unsere Art zu kommunizieren stark gewandelt, das wirkt sich auch auf die politische Kommunikation aus. Wie wichtig ist es für Politiker*innen, in den sozialen Medien präsent zu sein?
Ohne kann man sicher kaum noch erfolgreich politische Kommunikation betreiben. Aber kein noch so guter Post oder Tweet ersetzt am Ende den direkten Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern, das Kümmern um deren Probleme. Natürlich kann ein Insta-Reel helfen, Probleme deutlich zu machen, aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben, wenn wir grundsätzliche Veränderungen in der Gesellschaft im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung erreichen wollen.
Viele Leute erkennen, wogegen sich DIE LINKE wendet, aber wissen nicht unbedingt, wofür die Partei steht. Fehlt der Partei eine positive Erzählung, die zeigt, wie die Zukunft sein könnte?
Ich glaube, die Menschen wissen eigentlich ganz gut, was wir wollen, wofür wir uns einsetzen, aber es bleibt die Frage der Durchsetzungsfähigkeit. Und wenn sich die Partei dann noch mehr mit sich selbst beschäftigt, statt sichtbar für die gemeinsamen Ziele zu streiten, wachsen Zweifel an ihrer Existenzberechtigung. Wenn man sich dann noch in gegenseitigen Schuldzuweisungen ergeht, bleibt eben für das, was du positive Erzählung nennst, kein Raum mehr.
Wie könnte dennoch eine solche Erzählung aussehen?
Unser Problem ist ein bisschen, dass es in der Welt kein Referenzobjekt für einen funktionierenden demokratischen Sozialismus gibt. Insofern ist eine positive Erzählung immer ein Stück Projektion von Hoffnungen und damit in der Gefahr, schnell an die graue Realität zu stoßen. Ich denke, dass es noch mehr darauf ankommt, dass die Menschen merken, dass wir im Großen und im Kleinen für sie da sind. Dass die linke Sozialsenatorin in Berlin ein Netzwerk der Wärme organisiert hat, damit Obdachlosigkeit nicht lebensbedrohlich wird, ist ein Beispiel.
Foto: DIE LINKE / flickr.com